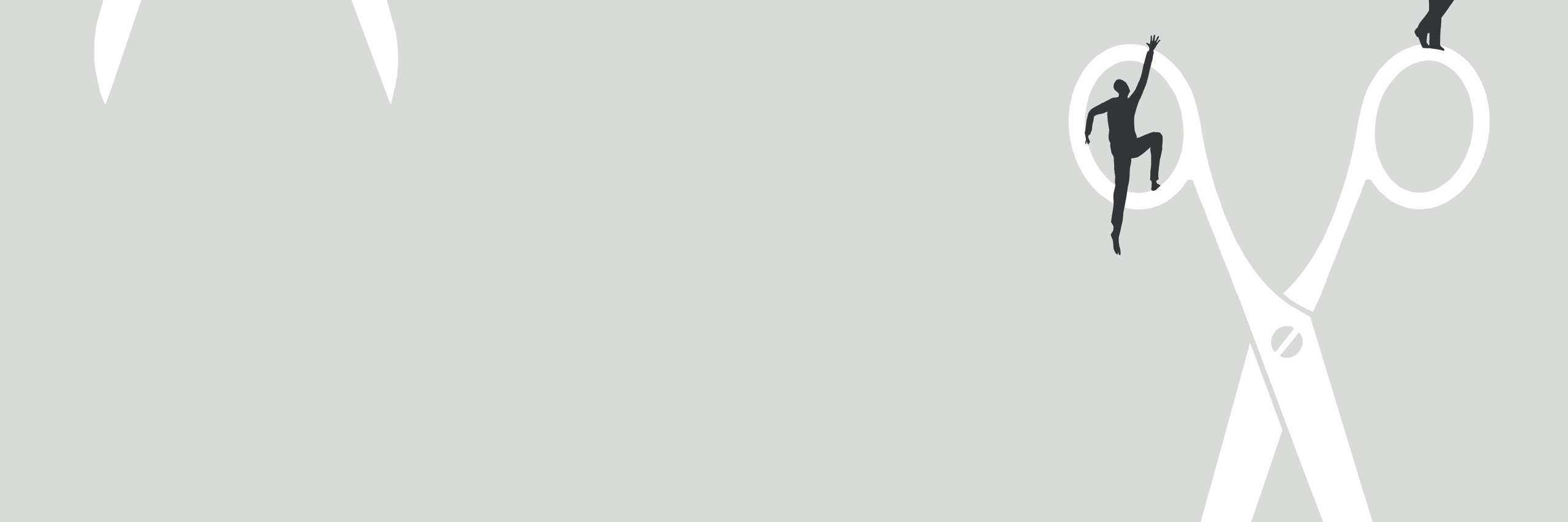
Win-win für alle – Unternehmerisch die Kluft überwinden
Dialogforum am 12. März 2019
properties.trackTitle
properties.trackSubtitle
Wirtschaftswachstum kann ein wirksames Mittel zur Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern sein. Eine zentrale Rolle kommt dabei Unternehmen zu. Wie können diese soziales Handeln unter immer härteren Wettbewerbsbedingungen realisieren? Welche Verantwortung tragen Investoren der Industrieländer in Entwicklungs- und Schwellenmärkten?
Politische und soziale Verhältnisse sind entscheidend
Wenn diese investieren und wachsen, hat das nicht nur einen unmittelbaren Effekt auf das eigene Einkommen, sondern es entstehen auch Arbeitsplätze für abhängig Beschäftigte. Der Unternehmenserfolg, so der Professor, sei dabei weniger von technologischen Problemen gehemmt als von den politischen und sozialen Verhältnissen. So biete etwa der Vertragsanbau in der Landwirtschaft, eine Vereinbarung zwischen Landwirten und Unternehmen bezüglich Saatgut, Dünger und Abnahmegarantien, die Möglichkeit, deutlich höhere Erträge zu erwirtschaften. „Dennoch verlassen viele Bauern diese sinnvollen Schemata, weil etwa erratisch aufgelegte Subventionsprogramme der Regierung günstiger erscheinen“, erläuterte Lay. Dies sei nicht nachhaltig. Deshalb plädierte er für feste Rahmen und Regeln, so dass Privatinitiativen gedeihen können. „Ohne funktionierenden Staat ist das leider nicht möglich."

Lay plädiert für feste Rahmen und Regeln des Staates, damit Privatinitiativen gedeihen können.
Auch viele deutsche Unternehmen investieren in Schwellen- und Entwicklungsländern. Knackpunkt sei es, genügend qualifiziertes Personal zu finden. Hier könne der deutsche Mittelstand – falls er beteiligt ist – wertvolle Unterstützung leisten, indem er beispielsweise die Qualifikation von Mitarbeitern selbst in die Hand nimmt oder unterstützt.
Konzept des sozialen Unternehmens
Einen anderen Ansatz zur Förderung unternehmerischen Handelns verfolgt die gemeinnützige Organisation betterplace.org. Auf deren Spendenplattform können Interessierte internationale sowie lokale Hilfsprojekte finden und unterstützen. „Bei uns steht das sozialunternehmerische Konzept im Vordergrund, bei dem es nicht in erster Linie um die Profitmaximierung geht. Wir wollen sozialen Herausforderungen begegnen und Lösungen unterstützen“, erläuterte Carolin Silbernagel, die der Organisation vorsteht. Ein erfolgreiches Beispiel für Sozialunternehmertum ist die Handy-App „Share a Meal“ des UN World Food Programme. Mit einem einfachen Klick ist es möglich, selbst kleinste Beträge zu spenden, um sich gegen den Hunger in der Welt zu engagieren. Für nur 40 ct, die sich hierzulande jeder leisten kann, bekommt ein Mensch in einem Entwicklungsland ein vollständiges Essen. Auch wenn in der philanthropischen Armutsbekämpfung in Deutschland inzwischen Milliardenspenden zusammenkommen, sollte man sich immer fragen, wo der einzelne Euro die stärkste Wirkung entfaltet. „Große positive Effekte werden beispielsweise durch Tabletten zur Entwurmung entfaltet. Wurmkrankheiten sind in armen Ländern ein großes Problem. Sie hemmen Entwicklung. Gegenmittel sind günstig und verhindern, dass erkrankte Kinder die Schule versäumen, was ein großes Bildungshindernis darstellt“, machte Silbernagel klar.

Moderator Busse leitete die offene Diskussionsrunde zwischen Plenum und Experten (Carolin Silbernagl, Jann Lay, Christiane Laibach v.l.).
Nebenwirkungen beachten
Dass soziale Entwicklungshilfe die Entwicklung eines Landes unterhöhlen kann, ist eine Gefahr, die nicht wegzudiskutieren ist. „Jede Einmischung von außen verändert etwas im System“, gab Silbernagel zu bedenken. Neben positiven Effekten sollte man daher auch die Nebenwirkungen beachten. So müsse man beispielsweise aufpassen, dass Spenden nicht ein ungünstiges System zementieren. Außerdem plädierte sie dafür, mehr über die negativen Folgen unseres Handels zu forschen und die Akteure vor Ort als Partner auf Augenhöhe ernst zu nehmen. „Günstig ist es“, so Silbernagel, „wenn diese auch federführend in die Projekte eingebunden werden.“
„Wir sollten systematischer darüber nachdenken, wie man Strukturen vor Ort günstig beeinflussen kann und nicht nur auf die Effektivität von Hilfen schauen“, ergänzte Lay. Nachhaltige Lösungen zum Beispiel im Gesundheitssystem könne man nicht erreichen, wenn man beispielsweise nur Entwurmungstabletten verteilt. „Es geht darum sicherzustellen, dass die Menschen ohne Intervention von außen in der Lage sind, sich selbst zu helfen.“
Ein anderes Problem ist, dass es in vielen Ländern häufig an lohnenden Objekten für Investitionen mangelt. Zinsen, die Kleinstunternehmen zahlen müssen, bewegen sich mit 20 oder sogar 40 Prozent pro Monat in astronomischen Höhen. Deshalb stürzen sich die Investoren gerne auf die Startup-Szene in großen Städten wie etwa Nigeria oder Kenia. „Jeder möchte ein Stück vom Kuchen abhaben“, berichtete Silbernagel. Es mangelt ihnen häufig weniger an Kapital, öfter an qualifizierten Entwicklern.
Verbraucher in der Verantwortung
Unbestritten ist, dass auch wir als Verbraucher eine Verantwortung für die Armutsbekämpfung tragen. Wir dürfen nicht nur auf den Preis schielen, sondern müssen auch die Arbeits-, Umwelt- und Sozialstandards berücksichtigen, unter denen die Konzerne ihre Produkte herstellen. „Die Intelligenz des Konsumenten wird oft unterschätzt“, bemängelte Lay. Man muss den Konsumenten erklären, wie der Preis entsteht.

Damit Hilfe zur Selbsthilfe funktioniert, müssten politische Eliten in den Ländern in die Verantwortung genommen werden, fordert Laibach.
Das nächste Dialogforum findet am 4. April 2019 zum Thema „Riesterflop, Hartz 4 und Kinderarmut – Wohin steuert Deutschland? Wohin treibt die EU?“ statt.
18. März 2019